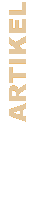 |
II. Interview Breidablick Brand-Odem würzt Denn Odin schweigt, Dorthin verbannt, Fahr auf! Entweich Tritt in die Halle
RS: Ich würde die Dinge nicht so scharf voneinander abgrenzen. Letztlich ist es immer die Nuance, die zählt. So sehe ich keinen Grenzwall zwischen Kultus und Kunst, sondern habe mich zu fragen, wo ich den Haupt-Akzent setze. Denn die Macht des Religiösen ist nicht zu bestreiten, doch wie es aufzufassen und zu deuten sei, das bleibt ein weites Feld. Kultisches kann als Kunst wahrgenommen werden, was nicht nur die Tempel der Griechen bezeugen, sondern auch Bauten, Bild- und Musik-Werke der christlichen Tradition. Andrerseits ist es legitim, Dichtungen wie Goethes „Faust“ oder „Pandora“, Wagners Nibelungen und Grals-Phantasien nach ihren mythischen Unter- und Hintergründen zu befragen. Aber sicherlich wollte Goethe mit dem „Faust“ keine Religion stiften und Wagner im „Ring“ nicht die nordische Götterwelt mit ihren Riten und Kultstätten restituieren. Beider Werk und, wenn ich mich einschließen darf, auch das meine setzt sowohl die geschichtliche Vielfalt religiöser Phänomene als auch die kritische Sicht auf sie voraus. Wer heute zum Kultus will, kann die Gipfel der Kunst nicht verleugnen und, was das Philosophische betrifft, nicht hinter Kant zurück. Ich glaube also nicht an die Wiederkunft vorchristlich-heidnischen Brauchtums, so wenig wie ich den Aberglauben an die „historische Aufführungspraxis“ in der Musik teile. Aber wenn man mich in dem Sinne apostrophiert, wie man etwa Goethe den „Großen Heiden“ nannte, so hätte ich nichts einzuwenden. TL: Ihrer Dichtung wohnt ein großes Streben nach Transzendenz inne, ein symbolhaftes Denken und die Sehnsucht nach einem heroischen Menschenbild. Gibt es einen künstlerischen Zwiespalt, der darin besteht, etwas herbeizusehnen, was nicht sein kann oder sein darf? RS: Hierauf antwortete ich mit Schopenhauer: „Die Kunst ist überall am Ziel.“ Wenn ich ein Erlebnis, einen Traum, eine Erfahrung in die vollendete Wort-Gestalt überführt habe – oder besser doch: wenn ich aus Worten eine Welt erschaffe, so gibt es kein Darüber-Hinaus. Das Gedicht ist nicht Mittel zum Zweck, sondern als Quintessenz unserer Geistes- und Seelenkräfte das Höchste für uns Erreichbare, in dem wir Erfüllung, Erhebung und vielleicht Erlösung finden. Daß dieses Gebilde von konzentrierter Macht und Herrlichkeit, wenn es in andere Kontexte eintritt, als Glaubens-Bekenntnis, kultischer Akt oder politischer Aufruf wirken kann, ist nicht ausgeschlossen, doch für den Autor ein sekundärer Effekt. Nicht die Gesinnung, sondern die Qualität entscheidet. Und nicht der Priester und schon gar nicht der Politiker – der Dichter stiftet die Hierarchie. TL: Obwohl Ihr Schaffen keinerlei tagespolitische Bezüge aufweist, wurden Sie doch gelegentlich mit dem Vorwurf der Rechtslastigkeit konfrontiert. Eine Angriffsfläche (für jene, die Sie unbedingt angreifen wollen) bietet sich dort, wo Sie Ihre Gefährten sehen: Mit Ernst Jünger unterhielten Sie eine langjährige Brieffreundschaft über die innerdeutsche Grenze hinweg, die 1989 auch zu einem persönlichen Treffen führte, und mit Arno Breker veröffentlichten Sie gemeinsam das Buch „Tage der Götter“. Auch mit Leni Riefenstahl waren Sie bekannt, widmeten ihr sogar ein Gedicht. Diesen künstlerischen Weggefährten ist das Streben nach einer heroischen Ästhetik und eine Sehnsucht nach Perfektion gemeinsam. Dies scheint für Sie eher ausschlaggebend als deren Verehrung in konservativen Kreisen. Doch wo genau sieht der Künstler Schilling selbst die verbindenden Elemente mit Jünger, Breker und Riefenstahl? RS: Ich stieß auf die drei Genannten, als ich mich nach Zeitgenossen umsah, die in ihrem jeweiligen Metier den ersten Rang vertraten. Das waren Ernst Jünger als Prosa-Autor, Arno Breker als Bildhauer und Leni Riefenstahl als Film-Künstlerin. Daß alle drei zur Generation meiner Großeltern gehören, ist kein Zufall. Jene, die nach dem Kriege in der Kunstszene prosperierten, hatten mir wenig zu sagen – alles, was mir lieb und teuer ist, kommt bei ihnen nicht vor. Sieht man sich nun die Werke von Jünger, Breker und Riefenstahl genauer an, so wird man große Unterschiede zwischen ihnen bemerken, aber das übergreifend Gemeinsame mag in der Tat sein, daß sie einen Traum von Größe und Vollkommenheit hegen, dem sie sich anzunähern versuchen und den sie in ihren besten Augenblicken verwirklicht haben. Daß die Wertschätzung eine gegenseitige war und alle drei mir mit großer Herzlichkeit begegneten, war beglückend für mich und bestärkte mich auf meinem Weg. TL: Die Verbindung zu und die Bezugnahme auf zwei DER Protagonisten nationalsozialistischer Kulturpolitik und einem der bedeutendsten Vertreter der "Konservativen Revolution" ist von außen betrachtet eine politisch eindeutige Auswahl und läßt vermuten, daß Ihr Werk in einem ähnlichen politischen Kontext zu verorten ist. Wird damit nicht auch Ihre ablehnende Haltung gegenüber einer Vereinnahmung Ihres Werkes durch jedwede politische und religiöse Weltanschauung zumindest fragwürdig? RS: „Zum Erbe, das Hitler uns hinterlassen hat, gehört die wechselseitige Furcht zweier Gesprächspartner, der jeweils andere könne „zu rechts“ sein, was zu einer absurden „Kultur“ der Distanzierungs-Rituale geführt hat. Alt- und Neu-Stalinisten dagegen sind im demokratischen Diskurs aller Ehren Wert. Aber das eine kann so wenig wie das andere der Maßstab sein. Sonst enden wir bei so fruchtlosen und typisch deutschen Diskussionen wie der Frage „War Goethe ein Demokrat?“ und müssen nicht nur die Bauten Timurs in Samarkand, sondern auch das Tadsch Mahal und tausend andere Groß-Werke der Weltkultur verwerfen. Um noch zwei Beispiele zu bringen: Für mich ist neben Ernst Jünger im zwanzigsten Jahrhundert der wesentliche deutsche Prosa-Schriftsteller Thomas Mann, ein Exil-Autor, der zu den entschiedensten und aktivsten Hitler-Gegnern gehörte. Unter unter den Musikern schätze ich Dimitri Schostakowitsch, der seine größten Werke unter dem Stalin-Regime schuf, als ein zwar gemaßregelter, aber auch mit höchsten Ehrungen bedachter Komponist. Das alles ist Schaum der Zeit, für die Mitlebenden wichtig, für die Nachwelt nicht so sehr. Rechts und Links sind keine ästhetischen Kategorien, da zählt am Ende, was die Zeit überwindet und für alle Zeiten gültig bleibt : das Können, der Stil, das Werk.“ TL: Die in Ihrem Werk zum Ausdruck kommende heidnische Symbolik hat einen universalen Charakter und greift auf griechische, ägyptische, nordische, keltische und buddhistische Mythen zurück. Wodurch wurde dieses poetische Feuerwerk entfacht? Hat die Kunst diesen Funken entzündet oder war es das Aufwachsen in einer mythisch geprägten Landschaft? RS: Beides trifft zu. Ich komme aus der Goldenen Aue zwischen Harz und Kyffhäuser; die Landschaft mit ihren Legenden ist mir von Kind auf vertraut, und sie gab mir, ohne daß ich darüber nachsann, erste Maßstäbe an die Hand. Vieles, was als zeitgemäß, modern, fortschrittlich propagiert wurde, erfüllte mich früh mit Unbehagen. Die Heimat meines Herzens lag anderswo, und der Zwiespalt vertiefte sich, als ich die große Literatur und Kunst der Vergangenheit kennenlernte. Hier war Nietzsche der Hauptschlüssel. Ich las ihn mit vierzehn Jahren und hatte mich zu fragen, warum dieser und allein dieser damals verfemte Autor mir Dinge zu sagen hatte, die niemand sonst mir offenbarte. Als zweiten Erwecker will ich Richard Wagner nennen. Er führte mich vom Begriff zum Symbol, von der Philosophie zur Kunst. Seitdem hat sich der Umkreis erweitert, bis ich im „Holden Reich“ Landschaft und Mythen der Heimat wieder entdeckte und fruchtbar machte für den Gesang. Doch bin ich dabei nicht stehengeblieben. Außer der Queste wurden der Horusfalke, das Einhorn, die Hydra, der östliche Drache, die Tigerblume wichtig für mich, und im letzten Jahrsiebend war Shiva mein Regent, ohne daß ich mich deshalb als Hindu bezeichnen würde. Man greift in den Schatz der Bilder und verwebt sie in sein Werk. Das sieht nach Willkür aus, aber es ist das Gegenteil davon. Denn wir sind nicht so autonom, wie wir glauben. Wir sind schon erwählt oder nicht und haben im Letzten keine Wahl. TL: Der Name der kleinen Ortschaft Questenberg im Ostharz steht nicht nur für einen ungebrochenen, im dortigen Volksbrauchtum gepflegten heidnischen Sonnenkult, sondern auch für eine vielfache Inspiration Ihres Werkes. Dennoch widerstrebt es Ihnen, sich mit dem tatsächlichen Kult vor Ort auseinanderzusetzen. Einmal mehr ist Ihnen das Symbolhafte wichtiger als die konkrete, „empirische“ Realität mit all ihren Unzulänglichkeiten. Auch erklärt sich hieraus vielleicht die Abgeschiedenheit des Eremiten: Der Dichter fungiert zwar als Seher und „Prophet“, will aber kein Menschenführer sein. Trotz der philosophischen Dichte Ihres Werkes gibt es keinen Leitfaden für das Alltägliche. RS: Ich möchte den Questenbergern nicht kritisch nahe treten, zumal ich ja ihr Fest nicht kenne. Vielleicht kann man es so sagen: Für mich ist die Queste Element einer Totalität, einer Welt, die ich zu erschaffen habe oder, wenn das zu prätentiös klingt, die mich zu ihrem Medium erkoren hat und in mir ihre Stimme findet. Woher es strömt und wo es endet, bleibt im Unbekannten, aber wir kommen nie weiter, als wenn wir nicht wissen, wohin unser Weg uns noch führt. TL: „Das Holde Reich“ ist das bei Ihren Lesern wohl beliebteste Buch. Der titelgebende Essay mit dem Zusatz „Quedlinburger Prolog“ nimmt Bezug auf Stefan George und kann als Aufruf zum Eintritt in einen Bund verstanden werden – ein Aufruf, der viel Zuspruch erfahren hat und noch immer erfährt. Der „Quedlinburger Prolog“ ist eine flammende Rede gegen die Geistlosigkeit; an der alten Kaiserstätte des „Traum-Harzes“ soll das Leben unter der Ägide von Nietzsche, Benn, Rilke und George neu beseelt werden. Sie schreiben dort: „Doch unser Stammbaum streckt seine Wurzeln in noch tiefere Schichten, unser Erbe kommt aus noch früherer Zeit. Wir reichen über die schlesischen Mystiker, über Martin Luther und Meister Eckehart zurück bis zu Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen, dem letzten Falkner und Minnesänger, und noch weiter, bis zu den sagenhaften Skalden der Vorzeit, den Rittern der Artusrunde und den Göttern der Edda. Dies ist der Strom, auf dem wir Segel setzen, wir Wikinger des Geistes. Dies ist der Wind, der unser Banner trägt.“ (3) Wer den Prolog liest, wird entweder von Ihrer kraftvollen Sprache mitgerissen oder legt das Buch kopfschüttelnd beiseite. Dazwischen gibt es nichts. In der Vorrede zum „Holden Reich“ – mittlerweile auch schon vor über zwanzig Jahren verfaßt – distanzieren Sie sich von einigen Aspekten Ihrer Schriften aus den Jahren 1977 bis 1980. Wie ist Ihr heutiger Blick auf das „Holde Reich“? Ich denke, für Ihre Leserschaft ist dies eines Ihrer wichtigsten Bücher, es gilt als spirituell und kulturell richtungsweisend, es hat für viele einen beinahe religiösen Charakter. RS: Die Lust am „Holden Reich“ mag ich niemandem ausreden. Es ist dies ein Buch, zu dem ich mich auch nach fünfundzwanzig Jahren durchaus bekenne. Meine Selbstkritik in der Vorrede bezieht sich auf den „Quedlinburger Prolog“ vom Mai 1981, und dies unter zwei Gesichtspunkten: Zum einen ist die Traditions-Linie recht eng gezogen, Novalis und George würde ich heute nicht mehr in die erste Reihe der Vorbilder stellen, zum andern kam ich von der Idee des Bündischen bald wieder ab, indem ich meine, es ist der souveräne Einzelne, der seine Zeichen setzt. Wenn sich viele darin wieder erkennen, so bezeugt das, wie schon gesagt, ein Über-Persönliches, das im Dichter nach Ausdruck verlangt. Aber diese Gemeinsamkeit ist eine erwünschte Folge seines Bemühens und nicht das maßgebliche Ziel. TL: Welchen Standpunkt vertreten Sie bezüglich des Personenkultes um Stefan George? In welchem Maße erleben Sie etwas Vergleichbares selbst? Ihr Werk erfährt zuweilen auch eine fast kultische Wertschätzung. Beglückt Sie dies oder empfinden Sie es als problematisch? Wie begegnet Ihnen Ihre Leserschaft? RS: Von mir möchte ich in diesem Zusammenhang absehen und nur auf die grundlegende Ambivalenz hinweisen: Man erfährt, wenn man das Außerordentliche darbringt, enthusiastischen Zuspruch wie schärfste Ablehnung, manchmal durch ein und dieselbe Person. Was Stefan George betrifft, so ist er mir als Dichter und Nachdichter bedeutend, weniger als „seher“ und „profet“. Man läuft, wenn man sich in diese Rolle begibt, immer Gefahr, zum Gefangenen des eigenen Mythos oder, böse gesagt, der eigenen Pose zu werden. So wurde George von Rilke überflügelt, der sich offenhielt und mit den „Duineser Elegien“ das maßgebende Werk der Epoche schuf. TL: Wie wichtig ist für Sie das freisetzende Element Ihrer Kunst? Wollen Sie bewußt wirken, oder suchen Sie zuallererst den Selbstausdruck? Beachten Sie Ihre Resonanz oder liegt jeder Wert in der Kunst allein? Sind Sie in diesem Zusammenhang zufrieden mit dem Erreichten, oder betrübt es Sie, daß sich die Medien zumeist bequemeren Dichtern widmen? RS: Auch hier kann ich an das eben Gesagte anknüpfen: Das Entscheidende ist der Selbst-Ausdruck, daß man genau das zur Sprache bringt, was einem am Herzen liegt, ganz für sich allein, ohne Rücksicht auf Echo und Resonanz. Das Paradox besteht aber darin, daß, je radikaler einer sein Ur-Eigenstes in Formeln und Sätze faßt, er auch für andere zum Künder, vielleicht sogar zum Führer werden kann. Wir kennen aus der Erfahrung eine Anzahl solcher Werke, die zunächst wenig beachtet wurden, weil nicht mit dem Zeitgeist konform, deren Wirkung dann um so nachhaltiger war. Ich will nur an Nietzsche erinnern, der seinem „Zarathustra“ den schönen Untertitel „Ein Buch für Alle und Keinen“ gab. TL: Auffällig ist Ihre Hinwendung zu Künstlern außerhalb des lyrischen Genres, da Sie sich ja selbst vor allem als Lyriker verstehen. Gibt es weitere Formen des Ausdrucks, die Sie pflegen oder in denen Sie sich versucht haben? Die Zusammenarbeit mit Arno Breker deutet auf eine Faszination für die plastisch-handwerkliche Gestaltungskunst hin. Haben Sie diese oder eine andere außersprachliche Kunstform selbst auch schon erprobt? RS: Fürs Handwerk fühle ich mich unbegabt, und ich bin auch kein Augenmensch. Meist muß man mich erst auf etwas aufmerksam machen, damit ich es sehe. In diesem Sinne bedeutet die Wendung zu Jünger, Breker, Riefenstahl auch einen Schritt zur Eroberung einer Domäne, zu der ich bis dahin kaum Zugang hatte: der sichtbaren Welt. Wogegen mich von jeher die Musik faszinierte. Das Lohengrin-Vorspiel war ein Türöffner für mich, und es gibt immer noch Aufschlüsse aus diesem Bereich. Auch habe ich gelegentlich auf Gitarre und Klavier dilettiert und ein paar Lieder komponiert. Seltsamer Weise hatte ich aber über die Jahre hin ausschließlich mit Bildenden Künstlern, Photographen und Filmleuten zu tun. Das hat sich erst in jüngster Zeit geändert, dank Uwe Nolte und Orplid. Der Dichter als Sänger kehrt an seinen Ursprung zurück. Sein Wort ist ja ein gesprochenes Wort, das nicht in der Lektüre, sondern durch die Stimme des Rhapsoden seine volle Wirkung gewinnt. TL: Immer wieder gelingt einzelnen Exponenten einer elitären oder subkulturellen Bewegung der Ausbruch aus der Abgeschiedenheit, und für einen Moment können die Massen an dem teilhaben, was sonst nur einer kleinen Minderheit vorbehalten bleibt. Unter diesem Aspekt ist auch das „Geheime Deutschland“ zu verstehen, das dieser Tage wieder in aller Munde ist, dessen Herkunft und Bedeutung den meisten aber verborgen bleibt. Stauffenbergs letzte Worte verkündeten die Losung der George-Jünger, die sich unter dem „Stern des Bundes“ aufmachten, das „Geheime Deutschland“ gleichermaßen zu er- und zu begründen. Das „Geheime Deutschland“ markiert den Aufbruch einer Dichtergemeinschaft von der Kunst in das Leben. Der Dichter ist nicht nur Künstler, sondern zugleich Religionsstifter, Kultleiter und Prophet. RS: Den politischen Alltag in der DDR habe ich wahrgenommen und kann auch auf eine Stasi-Akte von acht Bänden verweisen. Doch waren diese Verhältnisse, nachdem ich einmal in die Entschlossenheit eingetreten war, für mich irrelevant. Man tut das Seine, man drückt sich aus, man hat keine Wahl und fragt nicht danach, wie sich andere dazu stellen oder ob man sich in Gefahr begibt. In dieser Hinsicht ist die Situation im Jahre 2007 nicht anders als im Jahre 1986, als ich das „Geheime Deutschland“ schrieb. Davon zeugt auch die Tatsache, daß ich den Text unlängst im Völkerschlacht-Denkmal vortrug, als unvermindert-aktuell. Ich sah die DDR immer als das an, was sie war: eine Episode in der deutschen Nachkriegs-Geschichte, und demgemäß ist der Stellenwert, den sie in meinem Werk besitzt. Übrigens hat auch die BRD keinen höheren. Mit Nietzsche könnte ich sprechen: „Heut komm ich, weil mir’s heute frommt – TL: Welche Qualität muß ein Mythos besitzen, um von Ihnen verarbeitet zu werden? Gibt es einen „wissenschaftlich fundierten“ Anspruch an das Mythische, oder muß der Stoff für Sie persönlich faszinierend und von großer Strahlkraft sein? Gibt es Spielregeln, wenn Sie den Bereich der Götter betreten und diese agieren lassen? Lenkt Sie allein das Künstlerische, oder haben Sie im Hinterkopf auch die Historie, die versucht, das Thema mit wissenschaftlicher Genauigkeit zu behandeln? RS: Das sind Dinge, von welchen derjenige, der praktiziert, keine zu deutlichen Begriffe haben sollte. Was keinen Verzicht auf Nachdenken und Analyse bedeutet, aber das Schaffen steht im Vordergrund, und dazu gehört, daß man vieles beiseite läßt oder vergessen muß. Mir fällt ein Bonmot von Bernard Shaw dazu ein: „Do it, and if you can’t do it, teach it.“ Zeichen, Bilder, Mythen und Symbole treten ein – der religiös Ergriffene nimmt sie als Tatsachen, die er nicht hinterfragt, der Denker versucht sie zu deuten, der Dichter verwebt sie in sein Spiel. Und auch hier gilt, daß am weitesten kommt, wer sich offenhält, wer es in der Schwebe läßt, bis es von selber zu sprechen beginnt. TL: Um Ihnen vielleicht eine prophetische Aussage zu entlocken: Glauben Sie an ein Wiedererstarken der archaischen Mythen und Symbole? Auch in der populären Kultur findet sich zunehmend eine heidnische Symbolik, mit der nach Transzendenz gestrebt, aber auch nach den eigenen Wurzeln geforscht wird. Wenn schon nicht im Kult, wird das Heidnische in der Kunst zu neuer Blüte gelangen? RS: Wer den heidnischen Kultus ausübt, muß sich fragen, wie ernst es ihm damit ist, nicht anders als der Christ oder der Muslim. Und wer die Symbole in der Kunst verwendet, ebenfalls. Vieles, was man heutzutage hört und sieht, mag modisches Dekor sein oder leere Spielerei. Doch zeigt auch das Oberflächen-Gekräusel die tiefere Strömung an. An eine gleichsam reine Rückkehr zu den Wurzeln, die alles „Dazwischen“ ignoriert, glaube ich nicht. Und ich weiß nicht, ob sie wünschbar wäre. Aber die Mythen und Symbole, auch die christlichen, sind Ausdruck zeitlos menschlicher Dispositionen, von Leiden, Sehnsüchten, Aufschwüngen, Schwellen- und Grenz-Erfahrungen. Es kommt darauf an, wo das Schwergewicht liegt und wo man selber die Akzente setzt. Daß auch in einer Welt der Zersplitterungen, Einzel-Dinge, Partikular-Interessen Ganzheit, Fülle, Größe immer möglich sind, wird zuallererst durch die Kunst bezeugt. Sie gründet im Mythos und führt, vielleicht, zu ihm hin. Solange wir im Interregnum leben, hat der Dichter als Hüter der Schwelle, als Stifter der Hierarchien, als Retter der Phänomene sein Amt. TL: Ein besonders wichtiger Ort für das Neuheidentum sind die westfälischen Externsteine. Dort werden heute heidnische Rituale veranstaltet – ob auch die alten Germanen sie für ihre Kulte nutzten, ist ein Gelehrtenstreit, der wohl niemals beendet sein wird. Von den Nationalsozialisten unter der besonderen Aufsicht Himmlers – durchaus zum Ärger Hitlers – erforscht und zum Nationalheiligtum erklärt, ist diese steinerne Schöpfung der Natur heute ein beliebter Treffpunkt von Menschen unterschiedlichster Ausrichtung. Auch Rolf Schilling hat diese umstrittene und faszinierende Stätte besucht und schrieb darüber: „Seltsam ist es, daß ich vor einem Jahr erst von den Externsteinen erfuhr. Dieser Umstand mag zufällig sein, doch hat er, ins Ganze gerechnet, mit einem Tabu zu tun, das auf bestimmten Orten, Symbolen und Personen liegt. Andere sind stolz auf ihr Stonehenge oder ihr Lascaux, die Deutschen sind immer nur auf der Flucht vor sich. Man sucht das Mythische in Irland, in Indien, in der Karibik, der Menhir vor der Haustür gilt als „faschistisches Symbol“. Aber ich glaube, wir erweisen Adolf Hitler zu viel Ehre, wenn wir ihn zum Universal-Erben und Allein-Eigentümer des deutschen Mythos und aller kriegerischen Symbole erklären. Der Adler, die Schlange, der Gral, Wotans Speer und Siegfrieds Schwert, die Queste und der Echsenstein kommen von weiter her und bleiben fruchtbar für kommende Zeiten, fruchtbar vor allem für den Gesang. Wer sie verleugnet, wird das Heil nicht finden, er rodet seine Wurzeln und trübt den Quell.“ (4) In Ihrer Schrift „Echsenstein“ beklagen Sie den Verlust der Kultstätten durch die falsche Mythen-Zurückhaltung seit dem zweiten Weltkrieg, die alles Mythische auszurotten gedenkt. Wenngleich alles dafür getan wird, um die Externsteine von jedem Bezug zum alten Heidentum abzulösen, so sind sie doch zumindest heute eine Kultstätte. Spiegelt sich hier ein Überlebenskampf der Mythen wider, die vorübergehende politische und gesellschaftliche Episoden überdauern? Welche Eindrücke haben Sie an den Steinen empfunden? Gibt es etwas Weihevolles an diesem Tourismusmagneten? RS: Ich stand bislang zweimal an den Extern-Steinen und hatte dabei das Glück, die Erfahrung mit meinen Nächsten und mit fast niemandem sonst zu teilen. Der Eindruck war enorm, Verwandtes empfand ich, als ich zum ersten Mal an der Queste stand oder das Labyrinth in der Kathedrale von Chartres betrat. Offenbar gibt es Orte, die von Natur aus bevorzugt sind und die der Mensch, oft schon in früher Zeit, zur Kult- und Opferstätte erwählte. Da gibt es Gründungen, die bleiben werden und überdauern. Tourismus, Politik und selbst die Religion gehören zum Dekor, und daß man eine Vorliebe mit vielen gemeinsam hat, kann kein Grund sein, sie aufzugeben. Manchmal, wenn auch selten, ist es sogar das Gute, was allgemeinen Zuspruch findet. TL: Eine Konstante in Ihrer Dichtung ist die eingangs erwähnte Gestalt des Questers, die zum menschlichen Idealbild erhoben wird. Als literarische Referenz kommt einem die Gestalt Parzivals bei Wolfram von Eschenbach in den Sinn, der bei seiner Gralssuche allerlei Gefahren zu bestehen und Rätsel zu lösen hat. Parzival und Quester sind symbolische Initianden und verdeutlichen den Weg einer schrittweisen Initiation. RS: Der Quester ist für mich der Sucher und Frager, wie wir ihn aus den Grals-Legenden kennen, und zum andern derjenige, der an der Queste seinen Ritus zelebriert. Ernst Jünger nannte das einmal, bezogen auf den „Questen-Gesang“, die „mythisch-heraldische Grundhaltung“. Doch hat sich der Bogen dann weiter gespannt, die Gestalt gewann ein Eigenleben und erscheint bis heute immer wieder im Gedicht. Und dies im Sinne der beiden Komponenten, die Sie anführen: Der Weg führt ins Unermessliche, sein Ziel ist nicht abzusehen, aber es gibt auch Früchte und greifbare Resultate in der Form von Werken, die in sich vollendet sind. TL: Ihr Werk wird oft als Ausdruck eines Widerstandes gegen die Moderne aufgefaßt. Sehen Sie es als Teil eines solchen Bollwerks gegen zunehmende kulturelle und spirituelle Verflachung? Oder ist dies etwas, was sich einfach ergibt und aus sich selbst heraus entsteht, wenn man kompromißlos dem eigenen Weg folgt? RS: Man definiert sich nicht durch eine Anti-Haltung, sondern durch das, was man positiv auszusagen hat. Man kann damit im Widerspruch oder auch in Übereinstimmung mit dem herrschenden Zeitgeist sein. Das eine darf uns so wenig wie das andere beirren. TL: Eine ebenso banale wie interessante Frage: Für welche Bücher oder Musikstücke haben Sie sich zuletzt begeistern können? RS: Immer wieder glaube ich, alles Vortreffliche zu kennen, und was die Gedichte angeht, so mag es in der Tat so sein: Ich werde seit langem nur noch von eigenen Versen überrascht. Aber aus der Prosa gibt es immer noch Offenbarungen, die vorerst letzte waren für mich die „Bilder aus der Insektenwelt“ von Jean-Henri Fabre. Das war nicht nur der bedeutsamste Entomologe des neunzehnten Jahrhunderts, sondern auch ein Sprachmeister und Darsteller von hohem Rang, man schlug ihn für den Literatur-Nobelpreis vor. Als Musikstück fällt mir die achte Sinfonie von Schostakowitsch ein. Ich sehe in ihm das musikalische Pendant zu Breker und Riefenstahl. Namentlich in seinen Werken der dreißiger und frühen vierziger Jahre finde ich die tragisch-heroische Haltung manifestiert, wie sie auch in Brekers „Kameraden“ oder dem „Opfer“ zum Ausdruck kommt. Und dann gibt es noch die populäre Musik: Vor ein paar Jahren brachte mir ein Heide aus Westfalen den mexikanischen Zauberpilz stropharia cubensis mit. Einige Songs der Gruppe „Nirvana“, die ich jüngst hörte, erinnerten mich an jenen Zauberpilz-Trip.
Laß die göttlichen Symbole Sicher kannst du Opfer zollen, Denn die Zeichen, die wir fassen,
Thomas L. für nonpop.de
Verweise zum Artikel: » Noltex » Edition Roter Drache Themenbezogene Artikel: » ROLF SCHILLING: Lingaraja Themenbezogene Newsmeldungen: » Hörbuch von ROLF SCHILLING
Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln ausschließlich die Meinung des jeweiligen Verfassers bzw. Interviewpartners wieder. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung durch den Betreiber dieser Seite.




|









