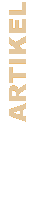Der verwässerte Begriff 'Independent' ist heute beinahe zu einem Schimpfwort geworden. Neue sogenannte Independent-Bands (schrammel schrammel) sorgen meist nur noch für müdes Augenrollen.
OKKERVIL RIVER aus Texas dagegen – die sich nach der Kurzgeschichte einer TOLSTOI-Nichte benannten, die wiederum dem gleichnamigen
Fluss gewidmet ist – sind auf angenehme Art und Weise gleich mehrfach 'unabhängig'.
Kennen gelernt hat sich die Urbesetzung, von der nur noch Sänger WILL SHEFF übrig ist, schon während der Schulzeit. Muffige Turnräume der High School eines 500-Seelen-Kaffs in New Hampshire mussten für erste Proben herhalten. Gemeinsam zog der Kern der Band nach der Schulzeit nach Austin in Texas, um Barren und Matten gegen Ölkanister in einer alten, rissigen Garage einzutauschen. Die erste Platte wurde Ende der 1990er-Jahre mit den Einnahmen aus Studentenjobs selbst finanziert, nachdem einige Labels nur loses Interesse bekundet hatten. Es folgten turbulente Jahre mit permanenten Besetzungs- und später auch Labelwechseln. WILL SHEFF erlitt in dieser Zeit eine Reihe von Nervenzusammenbrüchen, stets geplagt von Depression und Selbstzweifel. Der Sohn eines Lehrerehepaares kam, so erzählt er es in Interviews, irgendwann zu dem Schluss, dass er und sein Leben "ein absoluter Fehler, ein professioneller Fehler" sind. Mit diesem Eingeständnis – jederzeit scheitern zu dürfen, weil es gar nicht anders vorgesehen sein kann – ging es WILL fortan besser. Er hatte mehr Energie für Musik übrig, die sich seit Gründung von OKKERVIL an nichts anderem orientiert als am Instinkt der Band und vor allem ihres Chefs.
Die Texaner machten verrückten Folk, als noch niemand das Wörtchen 'weird' in den Mund nahm. Sie lieferten Britpop-Balladen, als kein Hahn nach Musik der GALLAGHER-Brüder krähte, verwendeten lange vor dem Erfolg ihres US-Kollegen
BEIRUT* und dessen "Gulag Orkestar" traurige Balkanbläser und griffen, als Countrymusik im Wesentlichen aus Nacktfotos der DIXIE CHICKS bestand, in die Saiten ihrer Banjos. *(OKKERVIL und BEIRUT verbindet übrigens die Schützenhilfe des mit beiden Projekten befreundeten JEREMY BARNES von
NEUTRAL MILK HOTEL.)
Vor drei Jahren gingen OKKERVIL RIVER mit ihrem vierten Album "Black Sheep Boy" (2005) auf Tour. Potentiellen Hörern waren sie damals noch nahezu unbekannt, unter Musikerkollegen hatte sich die Band allerdings längst einen Namen gemacht; so fragten die ungleich bekannteren
THE DECEMBERISTS gemeinsame Auftritte an. Ihren 'Durchbruch', also endlich mehr verdiente Aufmerksamkeit, feierte die Band 2007 mit ihrem Meisterstück "The Stage Names". Die 45 Minuten FolkRockCountryPop pendelten zwischen Depression und einer Ekstase, wie sie nur jemand erleben kann, der ansonsten dauerschwermütig ist. Das Album bekam durchgehend begeisterte Kritiken. Mit "The Stand Ins" liegt nun ein Nachfolger vor, der zunächst in den USA Anfang September veröffentlich wird. Nicht nur der Titel klingt ähnlich, auch die beiden Cover ergeben, aneinander gelegt, ein Bild. So haben die Stücke darauf natürlich ebenfalls mit dem Vorgänger zu tun: Eigentlich sollte "The Stage Names" ein Doppelalbum werden, aber WILL entschied sich dazu, einige der Songs lieber aufzuheben und auf ihrer Basis später ein weiteres Album herauszubringen. Damit sei "ein würdiger Nachfolger" (WILL) sicher gestellt.
Würdig ist er, aber nicht durchweg auf dem hohen Niveau von 2007. Einige Songs haben die emotionalen Extreme verloren, so als hätten sich OKKERVIL RIVER, nach Jahren der Niedergeschlagenheit, ganz gut eingerichtet in ihrer Countrypop-Welt, und das ist schade. Trotzdem präsentieren sie einige Höhepunkte, zu denen gleich der erste Song der Platte gehört. Eröffnet wird "The Stand Ins" allerdings von einem der drei über die CD verteilten Instrumentals, die allesamt in wenigen Sekunden viel Traurigkeit und Schönheit vereinen und spontan die isländischen Landschaften von
SIGUR RÓS vorbeiziehen lassen. Dann erklingt sie, die unverkennbare, immer leicht flatternde und absolut eindringliche Stimme von WILL SHEFF. Zum Besten gibt sie einen dieser leicht sehnsüchtigen Popsongs, zu denen in Musikvideos gutaussehende Menschen heulend an verregneten Fenstern lehnen. Bass und Rhythmus würden die Trauer ja aus dem Leben vertreiben, aber Banjo und Bläser halten sie zurück. Zynisch sind wie immer die Texte, mit denen WILL Geschichten aus dem fiesen Leben erzählt, von denen man ihm sofort glaubt, dass es seine sind. Erst mehrere Songs später packt er sein Können wieder aus, mit "Blue Tulip", einer der wehmütigen Balladen. Sätze wie "I feel so broke up, I want to go home" versteckt diese zunächst hinter dezentem Folkrock mit bluesiger Orgel, um sich im Verlauf der sechs Minuten hymnisch zu steigern. Auch "On Tour With Zykos" ist eine Klavierballade über eine verlorene Liebe, zu der sich hervorragend ein Strick nehmen lässt. Die Art von Zugabe, die erst gespielt wird, wenn sich das letzte Häufchen Publikum vorne am Bühnenrand versammelt. Das schönste Stück ist am Schluss versteckt: Ein fiktiver Monolog mit dem Glam-Rock-Sänger
BRUCE WAYNE CAMPBELL (1946 bis 1983), dessen Gemütslage in etwa der von WILL entsprach. Wunderbar, träumerisch, leise instrumentiert. Obwohl sich nahezu alle Instrumente der Platte ein Stelldichein geben (selbst die Steelguitar kommt hinzu), fällt hier auf, dass Geschichten, die WILL erzählt, eigentlich gar keine Musik bräuchten; die Intensität, die der Mann ausstrahlt, zieht die Instrumente an und hinter dem Text her. Ansonsten, also abgesehen von den geschilderten Höhepunkten: leider ein bisschen viel Standard-Cowboy-Folkrock. Wer THE DECEMBERISTS,
HOOD,
ARCADE FIRE, BEIRUT oder
THE MAGNETIC FIELDS mag, wird diese Platte auf alle Fälle lieben. An erster Stelle meiner OKKERVIL-Einkaufsliste steht sie aber nicht, dort nehmen vor ihr "The Stage Names" und "Black Sheep Boy" die Spitzenpositionen ein.
Zur Veröffentlichung in den USA starten OKKERVIL RIVER eine Tour, die teilweise auch nach Europa führt.
Die Termine: